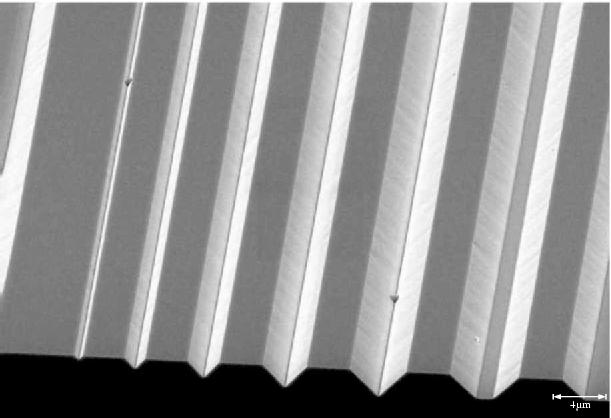Herstellung der Proben
Kapitel 2: Vorstrukturierung der V-Gräben
[…]
2.1 Ätzen der V-Gräben
[…]
2.1.1 Experimentelle Durchführung
| Prozeßschritt | Chemikalien | Parameter |
|---|---|---|
| Vorreinigung | ||
| Spülen | ca. |
|
| Spülen | ca. |
|
| Ätzen | ||
| Spülen | ca. |
|
| Spülen | ca. |
|
| Spülen | ca. |
|
Zunächst wird ein Wafer in die vier Viertel gespalten. Alles folgende bezieht sich nun auf eines dieser Viertel.
Die Tabelle 2.1 gibt einen Überblick
über die experimentellen Details des Ätzvorgangs. Das verwendete Brom hat die
Reinheitsstufe „pro analysis“. Ich habe ![]() Brom in
Brom in
![]() Methanol gelöst, man nennt es daher (etwas lax)
Methanol gelöst, man nennt es daher (etwas lax)
![]() -prozentiges
-prozentiges ![]() (Brom-Methanol).
(Brom-Methanol).
Die Ätzzeit von ![]() ist lediglich eine Richtzeit.
Anhand der TEM-Strukturen auf dem Wafer kann man recht leicht die Tiefe der
Ätzung abschätzen. Ich habe versucht, bei allen Wafern eine Ätzstufe
(AS) von
ist lediglich eine Richtzeit.
Anhand der TEM-Strukturen auf dem Wafer kann man recht leicht die Tiefe der
Ätzung abschätzen. Ich habe versucht, bei allen Wafern eine Ätzstufe
(AS) von ![]() –
–![]() zu erreichen, d. h. die
zu erreichen, d. h. die ![]() breiten Gräben der TEM-Struktur sind zum Teil bereits V-förmig, zum Teil noch
U-förmig. Eventuell wird dafür ein Nachätzen nötig.
breiten Gräben der TEM-Struktur sind zum Teil bereits V-förmig, zum Teil noch
U-förmig. Eventuell wird dafür ein Nachätzen nötig.
Die Flußsäure dient nicht nur dazu, das ![]() zu lösen,
sie besorgt auch die Endreinigung des Wafers vor der Bewachsung in der
MOVPE. Insbesondere werden einige anorganische Rückstände (z. B.
Oxide) gelöst, damit sie nicht das Wachstum auf den Seitenflächen
stören können Kaluza (2000, Kap. 7.1).
zu lösen,
sie besorgt auch die Endreinigung des Wafers vor der Bewachsung in der
MOVPE. Insbesondere werden einige anorganische Rückstände (z. B.
Oxide) gelöst, damit sie nicht das Wachstum auf den Seitenflächen
stören können Kaluza (2000, Kap. 7.1).
Die Abbildung 2.1 zeigt ein positives
Beispiel für ein geätztes Viertel. Die ![]() -Kanten sind einigermaßen
glatt, entsprechendes gilt für die Seitenflächen der Gräben. (Man beachte, daß
die Seitenflächen vor dem Bewachsen grundsätzlich wesentlich rauher
erscheinen.) Man sieht keine Löcher, die durch Reste der Ätze verursacht werden
können, und auch die Verschmutzungen halten sich sehr in Grenzen.
-Kanten sind einigermaßen
glatt, entsprechendes gilt für die Seitenflächen der Gräben. (Man beachte, daß
die Seitenflächen vor dem Bewachsen grundsätzlich wesentlich rauher
erscheinen.) Man sieht keine Löcher, die durch Reste der Ätze verursacht werden
können, und auch die Verschmutzungen halten sich sehr in Grenzen.
[…]
2.1.2 Versuch mit einer  -Maske
-Maske
[…]